In dieser Pandemie geht es den Kulturschaffenden ans Lebendige. Für freischaffende Künstler*innen ist es aktuell fast unmöglich, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Es ist wichtig, das nicht zu vergessen.
Aber als Rektor der Zürcher Hochschule der Künste beobachte ich auch spannende Dinge. Gerade aus künstlerischer Sicht passiert bei uns im Moment viel. Während des Lockdowns waren ja alle Studierenden und Dozierenden plötzlich zuhause. Wir stellten uns die grosse Frage: Wie wirkt sich das auf die künstlerische Arbeit aus? Und plötzlich ist da Potential aufgeblitzt, das wir im Unterricht vor dem Lockdown so nicht gesehen hatten.
Zum Beispiel beim Film, wo die Studierenden keinen Zugang mehr zum technologischen Equipment hatten. Dort sind mit der Handykamera unglaublich kreative Skizzen entstanden. Der Kern einer gelungenen Arbeit ist immer der künstlerische Gedanke. Wenn der Zugang zu Infrastruktur und zu Dozierenden plötzlich für eine gewisse Zeit nicht mehr im gewohnten Ausmass da ist, rückt dieser Kern stärker ins Zentrum. Die eigene Arbeit wird vielleicht existenzieller, wenn man mit dem Wenigen arbeitet, was man um sich hat.
Wie wir diesen Spirit behalten können, weiss ich noch nicht. Wir haben ein Projekt gestartet, quer durch die Hochschule, um Lehren aus dem Lockdown ziehen zu können. Es geht um Themen wie Home Office, virtuelle Sitzungen, virtuelle Forschungszusammenarbeit, virtuelle Lehre. Wir wollen nicht einfach in die alten Muster zurückfallen. Wir wollen prüfen, was wir aus dieser Zeit mitnehmen können.
Unsere Musikaufnahmeprüfungen sind ein gutes Beispiel dafür. Dort stammt fast die Hälfte unserer Studierenden aus dem Ausland. Früher war es normal, dass die Bewerber*innen für die Aufnahmeprüfung von weit her zu uns reisten. Das machen wir jetzt virtuell und werden das auch in Zukunft so halten. Aus musikalischer Sicht klappt das gut. Und es ist nicht nur ein grosser ökologischer, sondern auch ein zeitökologischer Gewinn.
Auch in anderen Bereichen gab es spannende Projekte. Den Lehrpreis 2020 hat zum Beispiel das Ljubliana Model erhalten. Eine wegen des Lockdowns abgesagte Exkursion für Fine-Arts-Studierende wurde digital inszeniert, mit Zugreise, Stadtrundgang, Atelier- und Museumsbesuchen, telematisch übertragenem Live-Konzert und virtuellen Abschlussessen. Verwendet wurden bei diesem kollaborativen Projekt zu einem grossen Teil existierende digitale Ressourcen wie Filme, Bilder, Street View und so weiter.
Digitale Räume werden nicht alles ersetzen. Der Austausch mit anderen Kulturen ist für uns essenziell, da ist der Kontakt vor Ort sehr wichtig. Aber auch hier sind wir am Ausprobieren. Ein wichtiges Projekt der ZHdK ist der Shared Campus, eine Lern- und Forschungsplattform, wo wir mit Kunsthochschulen aus Singapur, Kyoto, Taipei, London, Hong Kong, Paris, Amsterdam, Hangzhou, Tokyo und Utrecht zusammenarbeiten.
Was mir am meisten fehlt, ist der direkte Austausch mit den Menschen. Ich sehe am Screen weniger gut, wie sich jemand fühlt, ich kann Mimik und Gestik kaum mehr lesen, Befindlichkeiten schlechter einschätzen. Und einfach durch den Gang zu laufen und zufällig jemanden zu sehen oder gesehen zu werden, diese glücklichen Zufälle gibt es nicht mehr. Es ist mir erst in dieser Zeit aufgefallen, wie wichtig diese spontanen Begegnungen bei der Kaffeepause sind, wie wichtig Geräusche, Gerüche, persönliche Nähe sind. Online riecht es eben nicht nach Kaffee.
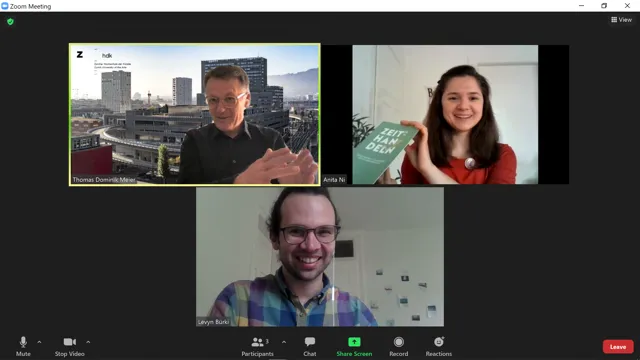
Unsere Empfehlungen zum Weiterlesen:



